
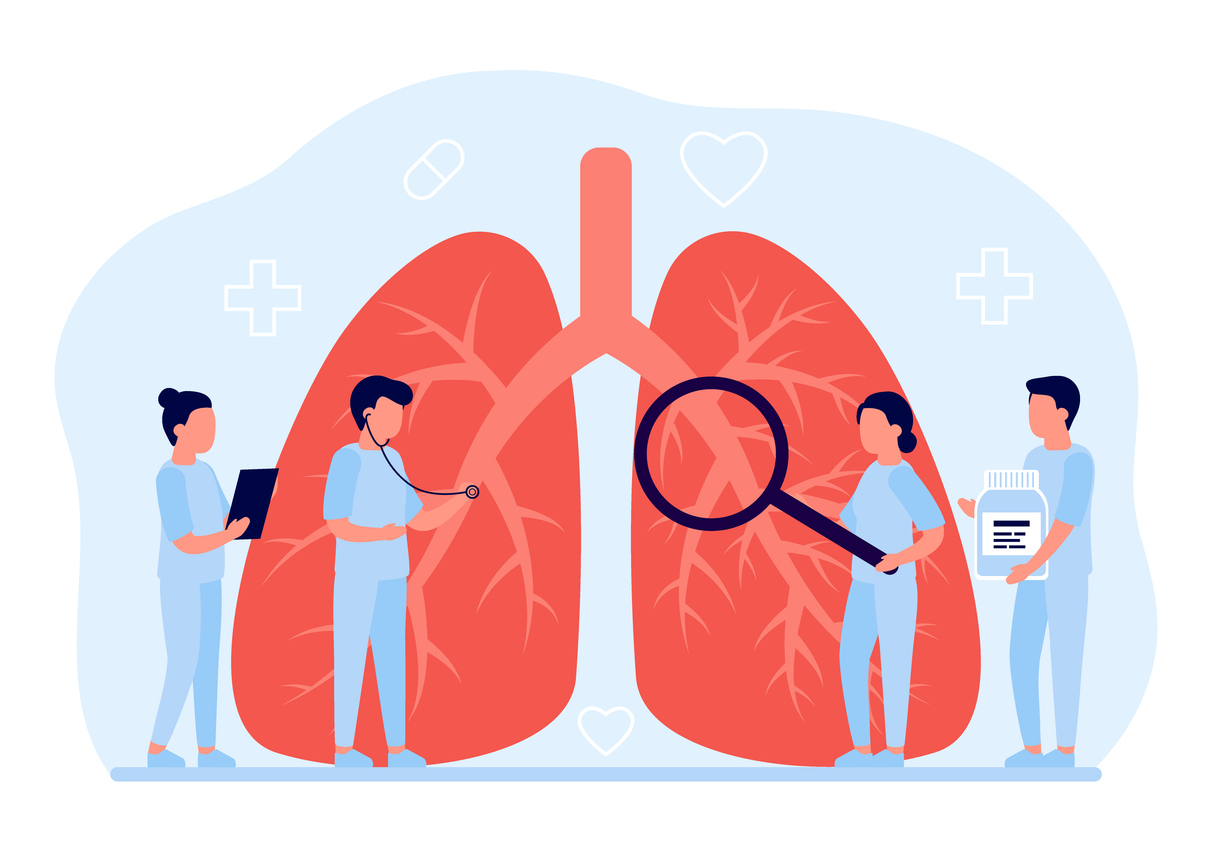
Die „Waisenmedizin“
- Juni 15, 2024
- Im übertragenen Sinn spricht man bei seltenen Erkrankungen von einer Waisenmedizin, weil derartige Leiden lange Zeit nicht im Blickfeld von Wissenschaft und Industrie lagen. Sie waren gleichsam „verwaist“. Manche rücken nun jedoch zunehmend in den Fokus. Aus guten Gründen.
- Text: Dr. Alfred Klement
Wie häufig eine Krankheit auftreten darf, um noch als selten zu gelten, ist länderweise verschieden. Die Prävalenz liegt zwischen 0,39 bis 0,63 Promille. Eine solche Prävalenzzahl beschreibt den Anteil der Erkrankten in der Gesamtbevölkerung. Sie scheint zwar niedrig zu sein, doch bisher sind schon über 7.000 verschiedene Leiden mit „Waisenstatus“ (Orphan Diseases) beschrieben worden. Insgesamt schätzt man die Zahl der Betroffenen in den USA und Europa auf ungefähr 30 Millionen Menschen. Das entspricht in der EU 6 bis 8 Prozent aller Bürger. Hier gilt ein Leiden als selten, wenn weniger als 5 von 10.000 Einwohnern daran erkrankt sind. Die USA gehen von weniger als 7,5 pro 10.000 Einwohner aus, die Australier von weniger als 1 und die Schweizer sogar von weniger als 0,1.
Selten, aber leidvoll
Viele dieser seltenen Erkrankungen sind der Bevölkerung völlig unbekannt und selbst unter der Ärzteschaft nur Spezialisten geläufig. Dementsprechend lange dauert es oft, bis ein Facharzt die zutreffende Diagnose stellt. Inzwischen schon bekannt gewordene Krankheiten sind die kindliche Mukoviszidose oder die Leukämie. Auch die „Schmetterlingskinder“ werden medial öfters genannt, denn ihre Haut ist so empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Schon geringste mechanische Belastungen lösen Blasen, Wunden und Schmerzen aus. Wunden treten auch innerlich an den Schleimhäuten, in Mund, Augen, Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt auf. Schwere Formen verkürzen die Lebenserwartung. Manche seltenen Krankheiten rücken durch besondere Ereignisse oder Schicksale von Einzelpersonen ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist ein Beispiel für eine chronisch-degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der es zu fortschreitenden Muskellähmungen kommt. Die Kranken sind früh auf einen Rollstuhl angewiesen, später haben sie auch Schwierigkeiten zu schlucken, zu sprechen oder zu atmen. In vielen Fällen führt ALS innerhalb weniger Jahre zum Tod. Manche Menschen wie der Astrophysiker Steven Hawking lebten jedoch jahrelang mit der Krankheit und machten sie durch ihr Schicksal bekannt.
Ein Anreizsystem
Pharmafirmen sind in den Industriestaaten meistens privat finanziert und müssen die Investition mit Gewinn zurückverdienen. Bei sogenannten Volkskrankheiten gelingt dies leichter und schneller, im Fall von seltenen Krankheiten lohnt sich der Aufwand für die wenigen Patienten wirtschaftlich jedoch nicht. Daher wurde im Jahr 2000 ein Anreizsystem geschaffen, das inzwischen seinen Zweck erfüllt hat. Die Vorteile eines „Orphan-Drug-Status“ bestehen in Steuererleichterungen und dem Verzicht von Administrationsgebühren. Dazu kommt die Markenexklusivität für zehn Jahre. In diesem Zeitraum werden keine Nachahmer-Präparate zugelassen, solange die Versorgung gesichert und kein zweites Arzneimittel dem ersten überlegen ist. Dabei gilt ein Arzneimittel als ähnlich, wenn drei Kriterien erfüllt werden: gleiche molekulare Strukturen, gleicher Wirkmechanismus und gleiche therapeutische Indikation. Der Antrag auf Anerkennung als „Orphan Drug“ kann zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung beim „Committee for Orphan Medicinal Products“ (COMP) der Europäischen Arzneimittelagentur gestellt werden.
Die Patienten bzw. ihre Angehörigen haben oft eine jahrelange Odyssee hinter sich, bis endlich ein Arzt die wahre Ursache ihrer Erkrankung erkennt. Oft fehlt es dann aber an einem speziell zugelassenen Medikament. Seit 2000, als die EU begann, die Entwicklung von „Orphan Drugs“ zu fördern, sind nach Zählung des deutschen Verbands der forschenden Pharmaunternehmen 183 solcher Medikamente entwickelt worden. Im April 2020 waren allerdings laut EU nur noch 102 dieser Medikamente als „Orphan Drug“ zugelassen, weil ihr „Orphan-Drug-Status“ bereits abgelaufen war. Unter den seltenen Erkrankungen finden sich viele, die auf Gendefekten beruhen. Auch zahlreiche Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen- oder Eierstockkrebs und alle Arten von Leukämien sind darunter.
Laut Deutscher Gesellschaft für Neurologie betrifft ein Großteil der „Orphan Diseases“ das Gehirn und das Nervensystem. Die Deutsche Leberstiftung weist darauf hin, dass auch die Leber häufig betroffen ist. Im Jahr 2020 gab es 13 Neuzulassungen für „Orphan Drugs“. Darunter ist das erste Medikament zur Behandlung einer Hepatitis D (Bulevirtid), Osilodrostat beim Cushing-Syndrom und die schon dringend erwartete Gentherapie mit Onasemnogen-Abeparvovec bei spinaler Muskelatrophie vom Gentyp 1 (SMA1). Von den 13 neuen „Orphan Drugs“ sind alleine sechs für die Krebstherapie bestimmt.
“Sichtbar” machen
Verständliche Informationen über einzelne seltene Erkrankungen und ihre Therapie findet man im Internet (orpha.net). Das „Orphanet“ ist eine spezielle Datenbank, die das Wissen über seltene Krankheiten sammelt und so die Diagnose und die Behandlung von Betroffenen verbessert. Wesentlich ist dabei der gleichberechtigte Zugriff auf diese Informationen für alle Interessensgruppen. Orphanet pflegt darüber hinaus die Nomenklatur der seltenen Krankheiten (OR-PHA code), die die Sichtbarkeit von seltenen Krankheiten in Informationssystemen von Gesundheits- und Forschungseinrichtungen verbessert.
Orphanet wurde im Jahr 1997 in Frankreich von INSERM (Französisches nationales Institut für Gesundheit und medizinische Forschung) etabliert. Die Initiative wurde im Jahr 2000 zu einem europaweiten Anliegen und wird seitdem durch Fördermittel der Europäischen Kommission unterstützt. Orphanet besteht heute aus einem Konsortium von 40 Partnerländern aus Europa und weiteren Mitgliedern rund um den Globus.
Hohe Kosten
Die Kosten von „Orphan Drugs“ bewegen sich in Größenordnungen, die Privathaushalte überfordern. 10.000 Euro und mehr für einen Therapiezeitraum sind dabei keine Seltenheit. Andererseits kann eine derartige Behandlung den vorliegenden genetischen Schaden beheben und den meist kleinen Patienten ein normales Leben ermöglichen.
In Österreich ist das soziale Netz dichter geknüpft als in vielen anderen Ländern. Die jeweiligen Gesundheitskassen übernehmen im Kontakt mit den Spezialkliniken nach eingehender Prüfung die Behandlungskosten für solche medizinischen Sonderfälle, was bei den Privatversicherungen tariflich nicht vorgesehen ist.
Lesen Sie auch: Nervenschmerzen an der Wurzel packen
Kneipp Blog
Beliebte Beiträge


Kostbares Trinkwasser

Schwimmende Urahnen









